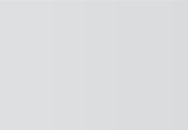Umstrittene Demokratie (IX und Schluss)
Vom rechten Gebrauch der Volksrechte: Integration oder Veränderung?,
in Wochen-Zeitung (WoZ), Nr. 21, 24. Mai 1996.
In der Schweiz hat sich die Demokratiedebatte in den letzten Jahren naturgemäss vor allem am Streit um die direkte Demokratie entzündet. Die Institution stösst, so hat die WoZ-Reihe «Umstrittene Demokratie» dokumentiert, auf linker Seite keineswegs nur auf Sympathie. Bezweifelt wird insbesondere ihre Tauglichkeit als Instrument der gesellschaftlichen Demokratisierung. Gleichwohl ist der Mobilisierungseffekt nicht zu übersehen, den der Gebrauch der Volksrechte bewirkt.
Bis heute wird das schweizerische Modell der direkten Demokratie in einigen Kreisen als radikale Errungenschaft gepriesen. Die über hundertjährige Erfahrung mit den Volksrechten legt jedoch ein differenzierteres Urteil nahe. Gerade in Fragen der Sozialpolitik hat sich die direkte Demokratie vielerorts als konservativer Hemmschuh erwiesen. Politologische Untersuchungen zeigen überdies, dass es mit der Kompetenz der Stimmenden nicht immer zum besten bestellt ist. Dem im Rahmen der WoZ-Serie namentlich von Oskar Scheiben und Ruedi Epple zu Recht kritisierten Mythos der gesellschaftsverändernden Wirkung der direkten Demokratie liegt unter anderem die Vorstellung zugrunde, deren Instrumente seien im 19. Jahrhundert hauptsächlich von der demokratischen Bewegung und von der Arbeiterbewegung erkämpft worden. Diese Vorstellung trifft die historische Realität nur teilweise. Sicher war in einigen Kantonen die demokratische und linke Bewegung eine erfolgreiche Promotorin, ohne Mitwirkung der Konservativen hätte sich aber die direkte Demokratie in der Schweiz nicht durchzusetzen vermocht. In den katholisch-konservativen Gebieten besassen die «politisch mündigen» Erwachsenen während Jahrhunderten verschiedene direktdemokratische Rechte – und sie nützten diese meistens so, wie es Ruedi Epple für Baselland festgestellt hat. Im Vertrauen auf den «traditionsgebundenen, gemässigten Volkswillen» machten sich die Konservativen im Ständerat 1890 – gegen den Vorschlag des mehrheitlich liberal-radikalen Nationalrats, der eine unverbindliche Volksinitiative vorsah – zugunsten der verbindlichen Volksinitiative in der heutigen Form stark; zusammen mit den demokratischen und linken Vertretern, die auf eine schrittweise Veränderung der Gesellschaft hofften, reüssierten sie.
Linke und konservative Motive
Die konservative Sichtweise wird gegenwärtig exemplarisch von Personen wie Christoph Blocher vertreten. Im Namen der Bewahrung der schweizerischen Identität erreichten diese Kreise, dass Schritte zur Öffnung der Schweiz und zur Reform des politischen Systems verhindert wurden: 1986 wurde der Beitritt der Schweiz zur Uno mit 76 Prozent massiv verworfen, der Beitritt zum EWR wurde ebenfalls abgelehnt (1992), und auch bescheidene Massnahmen zur Stärkung des Parlaments wurden 1992 mit rund 70 Prozent Nein-Stimmen gebodigt. Wen wundert’s, dass sich kürzlich die SVP an ihrem Sonderparteitag zur Verfassungsreform als «Hüterin der Volksrechte» empfahl? Diesen konservativen Aspekt der direkten Demokratie dürfte Friedrich Engels wohl gemeint haben, als er 1875 in einem Brief an Bebel gegen die «reine Modesache … wie zum Beispiel die ‘Gesetzgebung durch das Volk’, die in der Schweiz besteht», wetterte und befand, diese würde mehr Schaden als Nutzen anrichten, wenn sie überhaupt etwas anrichte. Die veränderungsfreudige Sichtweise vertraten in den vergangenen Jahren die mittlerweile verflossene POCH – die erfolgreichste Partei der 68er Bewegung – sowie Teile der Anti-AKW-Bewegung in den siebziger und achtziger Jahren und die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA). Diese und weitere Gruppen vermochten mit ihrem Gebrauch der direktdemokratischen Instrumente gewisse Erfolge zu verbuchen, sei es, dass sie – als Pol links der SP – mit ihren Forderungen Druck auf die etwas lahme SP der siebziger Jahre machen konnten, sei es, dass es ihnen gelang, selber Themen auf die politische Agenda zu setzen. Die Meinungen über die direkte Demokratie sind selbst in linken und alternativen Kreisen geteilt. Paradigmatisch lassen sich die beiden Positionen anhand von zwei Ereignissen in den achtziger Jahren darstellen: anhand der Studie von Gruner/ Hertig über den Wissensstand der Stimmenden und anhand des Abstimmungserfolges der Initiative «für eine Schweiz ohne Armee und eine umfassende Friedenspolitik».
Kompetente StaatsbürgerInnen?
1983 stellten die Berner Politikwissenschaftler Erich Gruner und Hans Peter Hertig ihre Auswertungen der Meinungsbefragungen (Vox-Analysen) zu den eidgenössischen Volksabstimmungen von 1977 bis 1980 vor. Eine ihrer wesentlichen Aussagen war, dass die Fähigkeit der BürgerInnen, eine Abstimmungsvorlage adäquat zu erfassen und begründet einzuschätzen, sehr beschränkt sei. Die sachliche Überforderung führt nach Gruner/Hertig dazu, dass die BürgerInnen in ihrem Abstimmungsentscheid manipulierbar sind; die Autoren ziehen gar den provokativen Schluss, dass Erfolge bei Volksabstimmungen im Prinzip käuflich seien. Ein solches Bild von überforderten und manipulierten BürgerInnen kontrastiert stark mit dem Lieblingsbild der «RadikaldemokratInnen», wonach aufgeklärte Privatleute bar jeglicher ökonomischer Interessen über politische Themen räsonieren. Zur selben Zeit, wie Gruner/Hertig ihre ernüchternden Analysen präsentierten, gründete Andreas Gross mit einigen Unentwegten die Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA). Mit dem unerwartet guten Ergebnis von 35,6 Prozent Ja-Stimmen im November 1989war die direkte Demokratie in den Augen mancher Linken wieder rehabilitiert. Einige GSoAtInnen machten sich daran, sich einerseits für einen Ausbau und eine Verfeinerung der Instrumente der direkten Demokratie in der Schweiz einzusetzen und andrerseits die Erfahrungen der direkten Demokratie auch europaweit zu diskutieren (Projekt «eurotopia»). Die VerfechterInnen der direkten Demokratie – die dabei hauptsächlich die Volksinitiative im Auge haben – können ihren Optimismus nicht nur mit dem überraschend guten Abschneiden der GSoA-Initiative begründen, sondern mit dem Phänomen, dass Volksinitiativen in Volksabstimmungen seit den achtziger Jahren besonders häufig reüssierten: Von den zwölf erfolgreichen Volksinitiativen seit 1891 – gegenüber 115 gescheiterten – wurden fast die Hälfte (5) nach 1982 angenommen: 1982 war erstmals nach über dreissig Jahren eine Volksinitiative (Einführung der Preisüberwachung) erfolgreich und setzte sich gar gegen einen Gegenvorschlag der Bundesversammlung durch. Darauf folgten weitere vier Initiativen, die bei Volk und Ständen eine Mehrheit fanden: die «Rothenturm»- Initiative (1987), die Initiative «Stopp dem Atomkraftwerkbau (Moratorium)» (1990), die Initiative «arbeitsfreier Bundesfeiertag» (1993) und die «Alpen-Initiative» (1994). Der steigende Erfolg führt zum vermehrten Gebrauch: Von den seit 1891 lancierten 261 Volksinitiativen datieren 43 Prozent aus der Periode 1981–1996 und sogar 61 Prozent aus der Periode 1971–1996.
Stärkung der Öffentlichkeit
Seit den siebziger Jahren hat die Volksinitiative – auch gegenüber den anderen Volksrechten – an Attraktivität gewonnen. Da direkte Abstimmungserfolge bei Volksinitiativen selten sind, dürfte der Grund für die Beliebtheit der Volksinitiative wohl bei ihren Nebenwirkungen liegen. Idealtypisch sind dies folgende: Mittels einer Volksinitiative können bestimmte Themen oder politische Alternativen, welche in der offiziellen Politik zuwenig oder nicht beachtet werden – unter weitgehender Ausschaltung des Parlaments –, direkt an die Öffentlichkeit getragen werden. Die Beteiligung an Volksabstimmungen vergrössert die politische Kompetenz der Stimmenden, die übrigens wahrscheinlich eher demokratie- denn sachpolitischer Natur ist. Besonders ausgeprägt sind die politischen Lernerfahrungen bei den Leuten jener Gruppe, welche die Unterschriftensammlung organisiert und die Abstimmungskampagne durchführt. Die direkte Demokratie trägt so zur Verbreiterung der politischen Elite bei. Volksinitiativen können gruppenbildende Wirkungen haben: Beispiele dafür sind nicht nur Gruppen wie die AKW-GegnerInnen oder die GSoA, sondern auch Parteien wie die heute nicht mehr existierende POCH, die ihren Aufbau wesentlich mit Volksinitiativen bewerkstelligte. Dies gilt auch für das rechte Lager: Die nationalistische Rechte verdankte ihre starke Präsenz in der Öffentlichkeit und im Nationalrat zu Beginn der siebziger Jahre weitgehend den verschiedenen «Überfremdungsinitiativen», und auch die AUNS – aus der Anti-Uno-Beitritt-Kampagne entstanden – dürfte ohne aussenpolitische Abstimmungen kaum jenen politischen Stellenwert haben, den sie gegenwärtig geniesst.
Von der Interessenspolitik zur Aufklärung
Als Fazit drängen sich folgende Überlegungen auf:
Die direkte Demokratie – selbst die Volksinitiative – ist kein besonders wirksames Mittel zur grundsätzlichen zielgerichteten Veränderung der Gesellschaft. Sie hat im Gegenteil eine integrierende Funktion, welche die längerfristige Stabilität des politischen Systems garantiert: Eine Volksinitiative – so radikal sie auch sein mag – ist höchstens ein «Schuss vor den Bug der Regierung». Das politische System schöpft selbst aus radikalen Volksinitiativen Legitimation.
Von der direkten Demokratie – namentlich dem fakultativen Referendum – profitieren primär finanz- und organisationsstarke Verbände. Für sie stellen die Instrumente der direkten Demokratie ein wirksames Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessenspolitik dar (Referendumsdrohung).
Die direkte Demokratie ist aber auch ein Instrument für jene Parteien und Gruppen, die in der offiziellen Politik zu kurz kommen. Sie können mittels Initiativen gleichgesinnte Leute finden und mit diesen ihre Forderungen und Ideen auf die politische Agenda setzen. Ein Beispiel dieser Art ist die GSoA.
Eine grundlegende Herausforderung der direkten Demokratie stellt dass Faktum dar, dass die StaatsbürgerInnen mehrheitlich schlecht informiert sind und dass sie unter dem Einfluss der marktorientierten Medien und einer PR-gesteuerten Politik stehen. Anstatt aber Zuflucht zum Abbau, zur «Verwesentlichung» der Demokratie zu nehmen, sollte besser versucht werden, die direkte Demokratie in eine aufklärerische Strategie der kulturellen Veränderung der Gesellschaft zu betten, wie dies der italienische Philosoph und kommunistische Politiker Antonio Gramsci mit seinem Konzept der kulturellen Hegemonie vorgeschlagen hat. Ihm zufolge sind die westlichen Gesellschaften nicht mit gewaltsamen Revolutionen zu verändern, sondern in der hartnäckigen Auseinandersetzung in den verschiedenen Bereichen der Zivilgesellschaft. In diesem Sinn mag der Ausgang einer Volksabstimmung sogar sekundär sein gegenüber der Möglichkeit, im Abstimmungskampf dem politischen Gegner die Führerschaft über bestimmte politische Themen zu entreissen. So kann die direkte Demokratie durchaus auch eine gesellschaftsverändernde Perspektive erhalten.
Die Demokratie ist nicht nur eine politische Ordnung oder ein Verfahren, sondern eine Grundhaltung, ein Grundwert, der verteidigt und weitergetragen werden soll. Bisher blieb die (direkte) Demokratie auf die institutionelle Politik beschränkt, während in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen – namentlich in der Wirtschaft – Partizipation und Gleichheit fehlen. Diesen Missstand hat bereits der junge Marx 1843 in seiner Kritik der Menschenrechtserklärung der französischen Revolution von 1789 thematisiert – und er ist heute noch aktuell. Der gegenwärtig ablaufende ökonomische Umverteilungsprozess führt uns dies drastisch vor Augen. Das ist jedoch kein Argument gegen die direkte Demokratie; es soll vielmehr eine Aufforderung sein, die Demokratisierung auch in anderen Bereichen anzustreben, sei dies die Wirtschaft, seien dies transnationale Gebilde wie die EU oder die Uno.