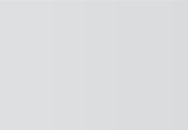-
Was ist mit der Linken los?
Ein Plädoyer des Berner Politologen Werner Seitz* gegen eine «sozialdemokratische Einheitspartei». Debatte (Teil 2)
«Die SP braucht Konkurrenz», in Wochen-Zeitung (WoZ), 28, 9. Juli 1998.
Was ist los mit der SP? Diese Frage scheint gegenwärtig die Schweiz zu bewegen. Besorgte Gemüter melden sich zu Wort und konstatieren Konzeptlosigkeit. Dabei ist nicht ganz klar, ob sich diese Diagnose auf die SP bezieht oder auf die Parteipräsidentin Ursula Koch, welche die Erwartungen der Medien und eines Teils des SP-Apparates nicht ganz erfüllen will.
Ein Rückblick auf das erste Präsidialjahr von Ursula Koch zeigt, dass der Start nicht optimal war: Da hatte die frisch gewählte Präsidentin anfangs nur beschränkte Kapazitäten frei, und das SP-Zentralsekretariat machte vor allem mit Turbulenzen um Zentralsekretärin Barbara Haering auf sich aufmerksam. Aus der Fraktion kamen schliesslich auch nicht die nötigen Hilfestellungen, so dass im Vergleich zur Ära Bodenmann «die Zügel schleiften». Dies alles aber der neuen Parteipräsidentin anzulasten, wird der Sache nicht gerecht. Wesentliche Teile des SP-Apparats waren und sind involviert. Aussenstehende konnten in diesem ersten Jahr der Ära Koch durchaus den Eindruck erhalten, dass sich einige von denen, welche sich Andrea Hämmerle als Parteipräsidenten gewünscht hatten, nicht besonders darum bemühten, die Anfangsschwierigkeiten von Ursula Koch zu verkürzen, und es in Kauf nahmen, dass die SP etwas ins Schlingern kam. All dies scheint der SP bislang jedoch keinen Schaden zugefügt zu haben, zumal wenn wir ihr Abschneiden bei den fünf kantonalen Wahlgängen betrachten, die in der Ära Koch stattfanden. Bei diesen vermochte sich die SP dreimal zu steigern (in Bern, Obwalden und Genf); in Glarus ging ein Prozentpunkt verloren, während für die Waadt aufgrund von Wahlkreisänderungen kein Vergleich mit den früheren Wahlen gezogen werden kann. Ich möchte daher die Frage nach der Lage der SP umformulieren zur Frage, weshalb es sich Teile des SP-Apparates «ungestraft» leisten können, die Parteipräsidentin nicht solidarisch zu unterstützen und der SP ein geschlossenes Auftreten zu verunmöglichen. Ich denke, hinter diesem Verhalten steckt die Sicherheit von Siegern, die keine Konkurrenz befürchten müssen: Die Grüne Partei der Schweiz (GPS) – die gegenwärtig einzig mögliche Konkurrenz für die SP – vermag seit einigen Jahren die SP weder elektoral noch mit eigenen Ideen und Konzepten ernsthaft unter Druck zu setzen. Für eine rotgrüne Politik ist dies, gerade auch in längerfristiger Perspektive, fatal. Wie konnte es so weit kommen, wo sich die SP doch in den achtziger Jahren noch auf ihrem historischen Tiefpunkt befand und die Grünen die stärkste Nichtregierungspartei waren?
Auf zu neuen Mittelschichten
Wie kaum eine andere Partei in den letzten Jahren hat sich die SP in ihrer Programmatik und ihrer Basis geändert: War sie bis in die siebziger Jahre die Partei der ArbeiterInnen und als solche zur Hauptsache zuständig für Fragen des Sozialstaates, so setzte sie in den achtziger Jahren – auch angesichts der Tertiarisierung der Gesellschaft – zu einem schmerzhaften und verlustreichen Umbau an, der in den neunziger Jahren zum Abschluss kam. In diesem Prozess bewegte sich die SP thematisch auf die neuen sozialen Bewegungen zu – verbunden mit einer gewissen Entideologisierung – und wurde eine Partei der neuen Mittelschichten. Letzteres zeigt sich etwa darin, dass die ArbeiterInnen bei den Nationalratswahlen 1979 unter den SP-Wählenden noch 36 Prozent ausmachten, 1991 jedoch nur noch 18 Prozent. Im selben Zeitraum stieg der Anteil der Angestellten und BeamtInnen unter den SP-Wählenden von 34 auf 66 Prozent. Die Folgen dieses Umstrukturierungsprozesses reichten bis zu Verlusten der traditionellen Stammwählerschaft. In Basel-Stadt, Freiburg und auch in anderen Orten spalteten sich in den achtziger Jahren gar traditionelle und gewerkschaftsnahe SozialdemokratInnen von der SP ab und formierten sich als Demokratisch-Soziale Partei (DSP). Nach dem nationalen Wahldebakel von 1987, als die SP mit 18,4 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1919 erzielte, beklagte sich der damalige SGB-Präsident Fritz Reimann, dass sich unter den Abgewählten vor allem Gewerkschafter befänden; er kritisierte die SP öffentlich, dass sie sich thematisch von den Sorgen der Arbeiter entfernt habe und vornehmlich «akademische Fragen» diskutiere. Wenn nun Andreas Herczog in seinem Artikel (siehe WoZ Nr. 27/98) konstatiert, dass beim letzten Abstimmungswochenende besonders die traditionellen SP-Hochburgen in der Stadt Zürich (die Kreise 3, 9 und 12) den Kredit für das Kontaktnetz kosovo-albanischer Familien verworfen und dass diese Stadtkreise bei den Ersatzwahlen in den Ständerat den SVP-Kandidaten Hofmann gegenüber der SP-Kandidatin Aeppli bevorzugt hätten, so realisiert er einen Prozess, der bereits in den achtziger Jahren angelaufen ist. Die SP und die traditionelle Arbeiterschaft haben sich teilweise entfremdet.
Zum Beispiel Bümpliz
Ein Pendant zu den Zürcher Stadtkreisen 3, 9 und 12 ist Bümpliz im Westen der Stadt Bern. Vor Jahrzehnten hatte dort die SP bei den Wahlen noch Traumresultate von 60 Prozent erzielt; bei den jüngeren Wahlen votierte nur noch rund jedeR Dritte für die SP; dafür gaben rund 20 Prozent ihre Stimme einer Rechtsaussenpartei. Für die Mehrheit der RotGrünMitte-Regierungskoalition (RGM) der Stadt Bern ist der Westen ein ganz besonderes Sorgenkind, steht dieser Stadtteil doch bei den Volksabstimmungen den RGM-Vorlagen meistens genauso kritisch-ablehnend gegenüber wie der bürgerliche Stadtteil Kirchenfeld.
Das Zürcher und das Berner Beispiel zeigen es deutlich: Die traditionellen Arbeiterkreise fühlen sich in der SP nicht mehr besonders heimisch; sie sind zur SP teilweise auf Distanz gegangen oder haben sich gar von ihr verabschiedet. Wer aber ausser der SP könnte es schaffen, diese Modernisierungsverlierer irgendwie noch einzubinden und davon abzuhalten, nach rechtsaussen abzuwandern? Wenn die SP versucht, wie es Herczog anregt, über das Wirtschaftskonzept mit diesen Kreisen zumindest in Funkkontakt zu bleiben, scheint mir dies ein sinnvolles Vorhaben zu sein.
Der Alleinvertretungsanspruch der SP
In den letzten Jahren hatte sich die SP vermehrt den neuen Mittelschichten zugewandt, was beträchtliche Wahlerfolge brachte – zumeist auf Kosten der Grünen. Die Grünen hatten dabei zusätzlich das Pech, dass die Wirtschaftskrise ihre ökologischen Themen in der politischen Prioritätenordnung zurücksetzte und dass sie – selber die Partei mit den anteilmässig meisten Frauen und dem ausgeprägteren frauenpolitischen Sensorium – zusehen mussten, wie der «Brunner-Effekt» der SP ein frauenpolitisches Markenzeichen ausstellte und der SP eine Reihe von Wahlsiegen mit besonders vielen gewählten Frauen bescherte. Die SP vermochte jedoch nicht nur dank programmatischer Anpassung an Forderungen der neuen sozialen Bewegungen wieder zu expandieren; sie integrierte auch ganze lokale und kantonale linke Formationen und diverse Einzelpersonen.
Als die SP im Herbst 1995 einen als historisch gepriesenen Wahlsieg errang, holte das Duo Bodenmann/Daguet zu einem eigentlichen Schlag gegen die RotGrünen links der SP aus: In einem Papier über die Lage der Linken empfahlen sie den kleinen linken, grünen und feministischen Gruppierungen die SP nicht nur als Referenzinstanz, sondern sprachen diesen geradezu ihre Existenzberechtigung ab und forderten sie zum «Abbruch der Übung» – und zum Eintritt in die SP – auf.
RotGrün muss gestärkt werden
Aus psychologischer Sicht war dieses Vorgehen der SP-Exponenten verständlich, war doch das ständige Schielen müssen auf die Konkurrenz der Kleinparteien, die stets beweglicher, kompromissloser und damit auch wirkungsvoller agieren konnten, ein Ärgernis. Doch leistete sich die SP nicht selber einen Bärendienst, wenn sie sich die diversen rotgrünen Kleinparteien geistig und materiell einverleibte? Hatten nicht gerade diese kleinen Parteien, angefangen von der Poch bis zu den Grünen und den Feministinnen, auch ihren Anteil daran, dass die SP in den letzten Jahren ihren insgesamt positiven Transformationsprozess vorantreiben konnte? Und bräuchte die SP nicht auch künftig solche Impulse von aussen? Doch gegenwärtig gibt es ja noch die GPS und eine Reihe von lokalen rotgrünen Formationen. Die GPS befindet sich zwar seit einiger Zeit in einem Formtief und die lokalen rot-grünen Formationen frönen einem eigenartigen Provinzialismus. Für eine erfolgreiche rotgrüne Politik ist es jedoch unabdingbar, dass sie sich nicht in einer «sozialdemokratischen Einheitspartei» abspielt, sondern dass es eine sinnvolle und produktive Arbeitsteilung gibt zwischen der SP und einer radikaleren (rot)grünen Formation mit nationalem Aktionsradius; realistischerweise bietet sich für letztere die GPS an. Dabei könnte sich die SP, die als Regierungspartei immer wieder gezwungen ist, Kompromisse einzugehen und «Realpolitik» zu betreiben, «auf die wesentlichen Fragestellungen» konzentrieren, wie sie von Herczog in seinem Artikel skizziert wurden. Eine (rot)grüne Nicht-Regierungspartei dagegen könnte radikaler politisieren, neue politische Konzepte entwickeln und testen und als Sauerteig die rotgrüne Politlandschaft beleben. Dabei hätte sie sich nicht auf die Funktion zu beschränken, der SP ihre geistige Beweglichkeit durch Ideenkonkurrenz zu erhalten. Es gibt genügend Beispiele dafür, dass es neben der SP eine national initiativ- und referendumsfähige Formation braucht, welche selber Forderungen aufs Tapet bringen kann und die SP – unter Androhung von Image-und Wahlverlusten – fallweise in Zugzwang bringen kann. Erinnert sei etwa an eher radikale politische Forderungen wie die GeGAV-Arbeitsumverteilungsinitiative oder die Initiativen für ein Waffenexportverbot oder für eine «Schweiz ohne Schnüffelpolizei», für die sich die SP nur halbherzig einsetzte – und die schmählich im Sand endeten. Das gegenwärtige Hauptproblem rotgrüner Politik in der Schweiz liegt meines Erachtens bei jenen Formationen im rotgrünen Segment, welche national nicht oder nur noch beschränkt handlungsfähig sind. Über die Stärkung und Vernetzung dieser Kräfte sollten die Diskussionen geführt werden – im Interesse einer gesamten rotgrünen Politik in der Schweiz. Eine rotgrüne Nichtregierungspartei könnte radikaler politisieren und neue politische Konzepte entwickeln.
*Werner Seitz,
Berater der «RotGrünMitte»-Regierungskoalition der Stadt Bern