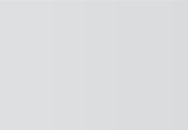Werner Seitz«Das Vertrauen in die linken Problemlöser».
Die sieben grössten Schweizer Städte waren bis vor kurzem rot-grün. Basel ist wieder bürgerlich. Jetzt wählt Bern. Ein historischer Überblick,
in Die Weltwoche, 46, 16. November 2000.
Städte zeigen sich gesellschaftlichen Neuerungen gegenüber offener als die Gemeinden auf dem Land. Dies erklärt sich aus ihrer besonderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Struktur und den Problemen, die sich daraus ergeben. Seit je stehen die Städte in Abstimmungen denn auch auf der Seite jener, die soziale und ökologische Vorschläge eher unterstützen, und seit je gelten die Städte als die Hochburgen der Linksparteien. Trotzdem waren sie nicht immer von den Linksparteien regiert. Im Gegenteil: Linksregierungen stellen, im historischen Vergleich, in den Städten die Ausnahme dar.Bis in die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren die Städte in bürgerlicher Hand. Ausnahmen bildeten kleinere Städte in der französischsprachigen Schweiz wie Le Locle oder La Chaux-de-Fonds. Ende der zwanziger und in den dreissiger Jahren, als sich im Zuge der Wirtschaftskrise die soziale Frage zuspitze, erzielte die SP in den meisten grösseren Städten Mehrheiten. Sie wurde dabei von den zum Teil starken Kommunisten gleichermassen unterstützt wie bedrängt. Diese Städte gingen als «rotes Basel», «rotes Zürich», «rotes Genf» oder «rotes Lausanne» in die Geschichte ein. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, die Folgen der Wirtschaftskrise zu lindern. Darüber hinaus betrieben die roten Städte – mit dem «roten Wien» als Vorbild – angesichts der massiven Wohnungsnot eine aktive Boden- und Wohnbaupolitik. Bedeutende Fortschritte erzielten die roten Städte auch beim Aufbau einer öffentlichen Grundversorgung (Verkehr, Elektrizität und Spitäler). Die roten Städte forcierten schliesslich auch den Ausbau der ersten Sozialgesetze und verkürzten die Arbeitszeiten beim öffentlichen Personal.
Die erste grosse «rote Stadt» entstand in Zürich, wo die SP schon seit 1900 die stärkste Partei mit drei bis vier Sitzen in der neunköpfigen Stadtregierung war. 1928 nahmen die Sozialdemokraten erstmals zu fünft in der Regierung Einsitz. Sie stellten mit Emil Klöti den Stadtpräsidenten und verfügten auch über die Mehrheit im Parlament. Das «rote Zürich» verstand sich als sozialdemokratisches Vorbild, das sich hauptsächlich dem Ausbau einer öffentlichen Infrastruktur widmete, dem Service publique, wie man heute sagen würde, sowie dem sozialen Wohnungsbau. Gegen diesen Reformismus, der das System nicht mehr überwinden wollte, versuchten die Kommunisten erfolglos Gegensteuer zu geben. Die Linie der Zürcher Sozialdemokraten wurde bald von der SP Schweiz gutgeheissen: Diese einigte sich an ihrem Parteitag von 1935 auf einen Kurs, der auf die Integration der SP ins politische System der Schweiz zielte. Es war dann fast logisch, dass 1943 mit dem damaligen Stadtpräsidenten Ernst Nobs ein Vertreter der Zürcher Linie als erster Sozialdemokrat in den Bundesrat gewählt wurde.
1946 wurde die SP-Mehrheit in der Zürcher Stadtregierung ein weiteres Mal bestätigt. Neben den fünf Sozialdemokraten nahm mit Edgar Woog noch ein Kommunist im Stadtrat Einsitz. Die neu gegründete Partei der Arbeit (PdA) hatte regen Zulauf und eroberte im Parlament fast zwanzig Mandate, halb so viele wie die SP. 1950 endet das «rote Zürich»: Die SP verlor ihre Regierungsmehrheit und die PdA, die nach dem Staatsstreich der Kommunisten in der Tschechoslowakei von 1948 in breiten Kreise bereits viel Goodwill eingebüsst hatte, flog aus der Regierung und brach im Parlament ein. Der Kalte Krieg marginalisierte die PdA in Zürich vollends. Die SP blieb dagegen weiterhin die stärkste Partei. Das Ende des «roten Zürich» bedeutete jedoch nicht, dass die Bürgerlichen an ihre Regierungsmehrheit der Jahrzehnte vor 1928 anknüpfen konnten. In den vierziger Jahre hatte sich nämlich der Landesring als drittstärkste Kraft in der Stadt etabliert; an dessen Stimmen war im Parlament schon das «rote Zürich» nicht mehr vorbeigekommen.Das extreme Genf
Als Gegenstück zum gemässigten «roten Zürich» gilt das «rote Genf», das allerdings auf kantonaler Ebene stattfand. Die Genfer SP verfolgte, zum Missfallen der Schweizer Zentrale der SP, einen ausgeprägten Linkskurs und war auch an ausserparlamentarischen Aktionen wesentlich mitbeteiligt. Das «rote Genf» fiel in die Zeit der grössten Wirtschaftskrise und der stärksten Polarisierung zwischen Bürgertum und Linken. Meilensteine auf dem Weg zum «roten Genf» waren ein Bankenskandal, in den die Bürgerlichen verwickelt waren, sowie die blutige Intervention von 1932 gegen eine antifaschistische Demonstration, bei der dreizehn Menschen ums Leben kamen. Die Bürgerlichen, die ein hartes Durchgreifen gegen linke Kundgebungen guthiessen, erhielten die Quittung bei den Wahlen von 1933: Die SP gewann die Mehrheit der Regierungsmandate und stellte mit Léon Nicole den Präsidenten der Regierung und den Polizeidirektor. Er war 1932 noch als einer der Hauptaktivisten der Manifestation verhaftet und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden.
In die drei Jahre des «roten Genf» fielen viele Streiks und Demonstrationen, wobei Letztere von Linken wie von Rechten organisiert wurden. Hauptproblem der roten Regierung ohne parlamentarische Mehrheit war, dass sie zwar Programme zur Linderung der Folgen der Arbeitslosigkeit lancierte, dass ihr aber angesichts der leeren Staatskasse die Hände gebunden waren. Eine Initiative der SP für eine Steuererhöhung wurde vom Volk abgelehnt. Nicht überraschend endete das «rote Genf» bereits nach drei Jahren. Die Genfer SP behielt jedoch ihren Linkskurs bei, was Folgen für Genf und, darüber hinaus, auch für die Waadt hatte: Als die SP Schweiz nämlich 1939 den linken Léon Nicole ausschloss, folgte ihm ein Grossteil der welschen Sozialdemokraten. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen sich die meisten von ihnen der neu gegründeten kommunistischen PdA an, deren erster Präsident Nicole wurde. In Genf blieben die Kommunisten bis zu den sechziger Jahren stärker als die SP.In Lausanne reichte es der Linken in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zweimal zu einer Mehrheit, allerdings nur für je eine Legislaturperiode: 1933 eroberte die SP, die vorher noch nie in der Stadtregierung vertreten gewesen war, gleich drei der fünf Mandate. Sie stellte den Stadtpräsidenten und erhielt auch im Parlament eine komfortable Mehrheit. Angesichts der Wirtschaftskrise waren im «roten Lausanne» die Prioritäten klar: Es wurden Beschäftigungsprogramme aufgestellt, Küchen für Arbeitslose und Notleidende sowie Schlafsäle für Obdachlose eingerichtet und Unterstützungsbeiträge für Miet- und Heizkosten ausgerichtet.
Bei den kommenden Wahlen jedoch musste die SP alle ihre Regierungsmandate wieder den Bürgerlichen überlassen, und auch im Parlament wurde sie wieder deutlich in die Minderheit versetzt. 1945 kam die Linke erneut zum Zug: Die Kommunisten, die sich auch in der Waadt im Aufschwung befanden, eroberten drei, die Sozialdemokraten zwei Sitze in der auf sieben Sitze aufgestockten Stadtregierung. Im Stadtparlament nahm die Linke die grosse Mehrheit aller Sitze ein, wobei auch hier die Kommunisten die Nase vorne hatten. Diesmal waren die Rahmenbedingungen für eine linke Politik bedeutend besser als in den dreissiger Jahren; die Linksparteien nutzen diese Möglichkeit: Unter der Führung des Stadtpräsidenten Pierre Graber, des späteren SP-Bundesrates, wurde der soziale Wohnungsbau forciert; es entstanden in dieser Zeit 2 200 Wohnungen. Besonders aufmerksam war die Stadt gegenüber Alten und Jungen: Sie leistete zusätzliche Unterstützungsbeiträge für Bezüger der noch jungen AHV und an die Stipendien für Studierende und Lehrlinge. Weiter wurde den städtischen Angestellten die Arbeitszeit gekürzt und ihre Ferien wurden verlängert. Bei den Wahlen von 1949 verloren die Kommunisten sämtliche Mandate in der Regierung, wodurch die bürgerlichen Mehrheitsverhältnisse wiederhergestellt wurden, die nun für einige Jahrzehnte andauern sollten. Anders als in Zürich und ähnlich wie in Genf blieben die Kommunisten im Parlament eine wichtige politische Kraft.Gewissermassen eine Zwischenstellung zwischen Genf und Zürich nahm das «rote Basel» ein, das von 1935 bis 1950 Bestand hatte. Einerseits waren die Kommunisten in Basel – wie in Genf und Lausanne – ein nicht vernachlässigbarer politischer Faktor: Ihre Stärke war immerhin etwa halb so gross wie jene der SP. Andrerseits aber war das Verhältnis zwischen diesen beiden Parteien ziemlich angespannt. Die Wunden, welche die Trennung von 1920 gerissen hatte, waren noch nicht verheilt. Immerhin hatten die Kommunisten 1935 aufgehört, die Sozialdemokraten als Steigbügelhalter der Faschisten zu attackieren, und arbeiteten vermehrt mit den Sozialdemokraten zusammen, allerdings nach dem Motto «Stützen und stossen». Die SP nahm diese Zusammenarbeit an, war sie doch im Parlament auf die Stimmen der Kommunisten angewiesen. Doch auch mit diesen verfügte sie nur zwischen 1938 und 1940 über eine Mehrheit im Parlament, vorher und nachher brauchten sie immer auch noch die Stimmen einiger Bürgerlicher. Die SP vermochte aber nicht nur solche im Parlament für sich zu gewinnen, sie schaffte es auch, bürgerliche Handwerkerkreise anzusprechen; diese profitierten von der grosszügigen Arbeitsbeschaffungspolitik des «roten Basel» und legten ihren traditionellen Antisozialismus-Reflex ab. Dank dieser Manövrierfähigkeit überlebte das «rote Basel» auch das Verbot der Kommunistischen Partei durch den Bundesrat von 1940, dem im Grossen Rat alle 15 KP-Mandate zum Opfer fielen.
Empfindlich getroffen wurde die SP von der zweiten Parteispaltung von 1944, als sich ihre Parteilinke der neu gegründeten kommunistischen Partei der Arbeit anschloss. Die SP verlor bei den Wahlen zehn Mandate, die PdA gewann 18. Besonders hart für die SP war, dass einer ihrer vier Regierungsräte, Carl Miville, ebenfalls zur PdA wechselte, die nun bis 1950 neben den drei Sozialdemokraten in der Regierung vertreten war. Als Miville 1950 die PdA verliess und sich ins Tessiner Exil zurückzog, fiel der Kommunistensitz an die Bürgerlichen, was das Ende des «roten Basel» bedeutete.
Dem «roten Basel» gelang es, einerseits die Folgen der Wirtschaftskrise mit einer grosszügigen Arbeitsbeschaffungspolitik zu dämpfen, und andrerseits die Sozialgesetze, die in Basel früh eingeführt worden waren, zu sichern und auszubauen.Berns eigener Weg
Einen eigenen Weg beschritt Bern, wo die SP bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit einem Vertreter in die fünfköpfige Stadtregierung eingezogen war und 1918 für eine Legislaturperiode die Mehrheit der Regierungsmitglieder und den Stadtpräsidenten stellte. Im Unterschied zu den anderen Städten gab es in Bern nur eine kleine kommunistische Partei. Deren Präsident war übrigens Henri Tschäppät, Vater des legendären SP-Stadtpräsidenten Reynold Tschäppät und Grossvater des SP-Nationalrates Alex Tschäppät, der heute für einen Sitz in der Berner Stadtregierung kandidiert. Bis in die fünfziger Jahre teilten sich FDP, SVP und SP die Macht in der Regierung, wobei die SP immer drei Mandate und gute vierzig Prozent der Parlamentssitze innehatte. In den späten fünfziger und frühen sechziger Jahren stellte die SP noch einmal die Regierungsmehrheit und bis Ende der siebziger Jahre den Stadtpräsidenten. Ab den sechziger Jahren verfügte in Bern kein Lager mehr über eine Mehrheit; das Junge Bern, eine nonkonformistische Organisation, spielte in der Regierung das Zünglein an der Waage zwischen den drei Sozialdemokraten und den drei Bürgerlichen.
Nachdem die Phase der «roten Städte» zu Ende gegangen war, wirkte die SP in den meisten Stadtregierungen als Konkordanzpartnerin mit. Eine Änderung bahnte sich in den achtziger Jahren an, als sich die Grünen als eigene Kraft etablierten und sich die SP dezidierter nach links orientierte und sich auch ökologischen und feministischen Themen gegenüber öffnete. Das Verhältnis zwischen den Bürgerlichen und den Linksparteien verhärtete sich zunehmend. Ohne dass auf kantonaler und nationaler Ebene einen Linksrutsch festzustellen gewesen wäre, fielen in den neunziger Jahren die meisten grösseren Stadtregierungen den rot-grünen Parteien gewissermassen in den Schoss: Gegenwärtig haben sechs der neun Städte mit mehr als 50'000 Einwohnern eine rot-grüne Regierungsmehrheit: Zürich, Bern, Genf, Lausanne sowie Luzern und Biel; mehrheitlich bürgerlich regiert werden die Städte St. Gallen, Winterthur und Basel.
Im Vergleich zu den dreissiger Jahren ist die SP heute in den meisten Städten auf einen Partner, die Grünen, angewiesen, um eine Mehrheit zu erringen; in der Romandie auch noch auf die Kommunisten. Gegenüber der dreissiger Jahre haben sich in den Städten jedoch die politischen Probleme verändert: Waren in den dreissiger Jahren die Wirtschaftskrise und die soziale Frage sowie der Aufbau einer öffentlichen Grundversorgung die Hauptthemen, so stehen in den heutigen Städten andere Fragen auf der Traktandenliste: erstens der Verkehr, der infolge der Trennung des Arbeits- und Wohnorts die Städte fast zum Erliegen bringt und die Stadt als Wohnort unattraktiv macht, sowie zweitens die sozialen Probleme, welche in den Städten konzentriert auftreten (Stichworte: Überalterung, Integration der Ausländer, Drogen). Aus diesen beiden Problemen resultiert in der Regel ein drittes: die Krise der städtischen Finanzen. Die Städte haben einerseits eher «schlechte Steuerzahler» (die «besseren» sind in die grünen Agglomerationsgemeinden gezogen), und so fehlen ihnen andrerseits häufig die Mittel, um für die sozialen und kulturellen Aufgaben, die sie zu lösen haben, aufzukommen.Entgegen der verbreiteten Meinung, die Grünen seien ein Produkt der Deutschschweiz, war Lausanne die erste Stadt mit Regierungsbeteiligung der Grünen. Der Einzug der Grünen brachte 1977, nach gut dreissig Jahren bürgerlicher Regentschaft, eine rot-grüne Mehrheit in Regierung und Parlament. Diese wurde allerdings nach vier Jahren wieder beendet. 1989 installierte sie sich erneut, in der derselben Zusammensetzung und mit einer knappen Mehrheit im Parlament, welche 1997 etwas ausgebaut werden konnte. Bei diesen jüngsten Wahlen erhielten die Rot-Grünen in der Regierung Verstärkung durch den Zuzug eines Kommunisten. Bei den Ergänzungswahlen in diesem Frühjahr allerdings musste die SP ein Mandat an die FDP abtreten; die rot-grüne Mehrheit blieb jedoch bestehen.
Wo bleibt der Unterschied?
In der Stadt Genf zogen die Kommunisten 1971 erstmals in die Stadtregierung ein und verstärkten die linke Präsenz in der fünfköpfigen Stadtregierung auf zwei Mandate. Zwanzig Jahre später entstand durch Zuzug der Grünen erstmals eine rot-grüne Mehrheit in der Stadt, die 1995 bestätigt wurde und auch im Parlament eine Abstützung fand. Vier Jahre später steigerten sich die Rot-Grünen in der Regierung gar noch um den Sitz der Linksallianz; die Bürgerlichen sind so nur noch mit einem Mandat vertreten. Seit 1995 verfügt die rot-grünen Parteien auch im Parlament über eine Mehrheit, allerdings nicht so komfortable wie in der Regierung.
In der Romandie änderte die SP ihren Kurs weniger stark in Richtung Ökologie und Feminismus, was angesichts der Stärke der Kommunisten und anderer Linksparteien wohl auch sinnvoll war. In der Deutschschweiz jedoch verlief dieser Prozess in den achtziger Jahren spektakulär und provozierte Abspaltungen und Austritte. Wegen dieses Kurswechsels büsste die SP nicht nur Wählerstimmen ein; sie verlor auch einige Mandatsträger in Parlament und Regierung. In Zürich etwa flog die SP 1982 gar ganz aus der Stadtregierung und fand erst 16 Jahre später zu ihrer alten Stärke von vier Mandaten zurück. Seit 1994 haben in der Stadtregierung auch die Grünen mit Monika Stocker und die neu gegründeten Christlich-soziale Partei von Willi Küng Platz genommen, was den rot-grünen Parteien eine solide Zweidrittelsmehrheit bescherte. Im Parlament verfügten die rot-grünen Parteien jedoch nur nach den Wahlen von 1990 über eine Mehrheit. Dies ist jedoch nicht der Grund dafür, dass die rot-grüne Regierung von Zürich keine dezidierte rot-grüne Politik macht. Vielmehr hat ein Teil der rot-grünen Magistraten mehr und mehr auch bürgerliche Postulate aufgenommen und zu Eigen gemacht: Wirtschaftsförderung, Standortmarketing, effiziente Stadtverwaltung und Sanierung der öffentlichen Finanzen sind die Schlagworte. Und so stellen sich «NZZ» wie «WoZ» gleichermassen die berechtigte Frage, was denn eine bürgerliche Regierung noch anders machen würde.
Den rot-grünen Städten ist gemeinsam, dass die SP zwar die stärkste Partei ist, dass sie aber alleine nicht mehr die Mehrheit der Mandate innehat und so auf Partner angewiesen ist – und hier regiert vielfach Genosse Zufall: Diese Partner können Grüne, Kommunisten, Linke oder Einzelpersonen sein. Meistens gibt es zwischen diesen Mehrheitsparteien keine längerfristigen Absprachen. Die rot-grünen Parteien in Bern gingen neue Wege, indem sie ein RotGrünMitte-Bündnis entwickelten mit dem Ziel, die Mitteparteien EVP und Landesring dauerhaft in eine rot-grüne Politik miteinzubeziehen.
Wesentlich für das RGM-Bündnis ist eine relativ umfassende Plattform, welche den Inhalt der Politik verbindlich festlegt, dies namentlich im Interesse jener Parteien, welche bei der Mandatsverteilung leer ausgehen sollten. Diese Plattform hatte nicht nur eine strukturierende Wirkung auf die Politik, welche die einzelnen Parteien des RGM-Bündnisses betrieben, sie strukturiert auch die Politik der einzelnen Parteien und band die Regierungsmitglieder in die RGM-Politik ein, wobei diese in begründeten Fällen durchaus auch abweichende Meinungen vertreten konnten. Ein Nebeneffekt dieser Regelung ist, dass sie eitle Sololäufe von Regierungsmitgliedern verhindert, welche anderswo manchmal beklagt werden. Das Berner RGM-Bündnis gewann 1992 die Mehrheit in Stadtparlament und Regierung, 1996 vermochte es diese zu konsolidieren. Die nächste Wahl findet am 26. November statt.Als einzige Stadt mit mehr als 100'000 Einwohnern hat Basel keine rot-grüne Regierung. Nachdem das «rote Basel» 1950 sein Ende gefunden hatte, stellten die Bürgerlichen 46 Jahre lang die Regierungsmehrheit. 1996 eroberte die SP drei Mandate; zusammen mit der gewerkschaftlich ausgerichteten Demokratischsozialen Partei (DSP) bestand so in einem gewissen Sinn eine Mitte-Links-Mehrheit. Aufgrund der politischen Ausrichtung der DSP, die sich in den achtziger Jahren als Reaktion auf den Linksschwenker der SP gebildet hatte, kam diese Mehrheit allerdings nur bei traditionellen sozialpolitischen Themen zum Tragen. Bei den jüngsten Wahlen eroberten die bürgerlichen Parteien wieder die Mehrheit in der Regierung.
Eine Bilanz der rot-grünen Mehrheitsregierungen der Gegenwart kann heute noch nicht gezogen werden. Es macht aber offensichtlich den Anschein, dass in der tiefen Krise, in der sich die Städte heute befinden, ähnlich wie in den dreissiger Jahren, linken oder rot-grünen Parteien und ihren Konzepten mehr Vertrauen entgegen gebracht wird als jenen der Bürgerlichen. Dazu kommt, dass die rot-grünen Regierungen keine lupenreine rot-grüne Politik betreiben, sondern durchaus auch wirtschaftsfreundliche Postulate vertreten, was breitere Allianzen mit Teilen der Bürgerlichen ermöglicht. Dies wiederum erschwert es den Bürgerlichen, die rot-grünen Regierungen inhaltlich zu attackieren, verärgert aber auch einen Teil der eigenen rot-günen Basis.
Dass ein solcher Kurs sinngemäss auch von den bürgerlichen Parteien erfolgreich gefahren werden kann, zeigten die jüngsten Basler Wahlen, bei denen die Bürgerlichen die Mehrheit zurückeroberten. Die vier gewählten Magistraten haben klare bürgerliche Standpunkte, sie haben jedoch in den vergangenen Jahren eine liberale und ökologische Sensibilität an den Tag gelegt, welche sie auch für potentiell rot-gün-Wählende wählbar machte.
* Werner Seitz
ist Politologe. Er leitet den Bereich «Wahlen und Abstimmungen» im Bundesamt für Statistik und war in den neunziger Jahren Mitglied der Beratungsgruppe der RGM-Parteien in der Stadt Bern