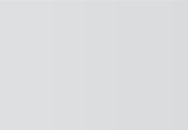Werner Seitz*
Meinungsbildung bei Volksabstimmungen: «Die Stimmberechtigten sind kein weisses Blatt…»,
in Revue der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, 142/2003, Nr. 1, S. 16 f.
Dieser Artikel wurde integral abgedruckt in: B-Post. Nachrichten von der kleineren Hälfte, hg. von der Stiftung Märtplatz, Freienstein 2003/4, S. 4–6, ergänzt um den Teil: «Sind Parlamentssitze käuflich?»
Als Anfangs der achtziger Jahre die beiden Berner Politologen Erich Gruner und Hans Peter Hertig nach einer Auswertung der ersten Meinungsumfragen zu den eidg. Abstimmungen (Vox-Analysen) zum Schluss kamen, dass Volksabstimmungen «im Prinzip käuflich» seien, war die Aufregung gross: Die einen hatten solches immer schon geahnt und wussten nun um den Grund für ihre Niederlagen, die anderen waren empört: «Wenn man das Buch liest, so glaubt man, wir lebten in einem Saustall», liess sich ein bürgerlicher Politiker verlauten.
Wie kamen die beiden Forscher zu diesem provokativen Schluss? Sie hatten in den Vox-Analysen untersucht, wie gut die Stimmenden den Inhalt der Abstimmungsvorlage kannten und wie gut sie ihren eigenen Entscheid begründen konnten – und das Ergebnis war ernüchternd: Die Kenntnisse waren über die verschiedenen Bevölkerungsgruppen sehr ungleich verteilt und je nach Art der Vorlage hatte ein mehr oder weniger grosser Teil der Stimmenden nur rudimentäre Kenntnisse. Den bescheidenen Kenntnissen der Stimmenden stand nun das Faktum gegenüber, dass in fast allen untersuchten Volksabstimmungen jene Seite gewann, welche das grössere Werbebudget hatte. Dies liess die beiden Forscher zum Schluss kommen, dass für den Abstimmungserfolg weniger die Qualität der Argumente als das zur Verfügung stehende Werbebudget ausschlaggebend sei.
Einfache und komplexe Abstimmungsvorlagen
Die Frage nach der Käuflichkeit von Volksabstimmungen blieb in dieser allgemeinen Form zwar unbeantwortet; sie wurde in der Folge jedoch modifiziert: In Anlehnung an die Feststellung, dass der Einfluss der Propaganda nicht bei allen Abstimmungen gleich stark sei, wurden zwei Typen von Abstimmungsvorlagen bzw. -themen unterschieden: stabil prädisponierte und labil prädisponierte. Stabil prädisponierte Abstimmungsthemen haben einen einfach verständlichen Inhalt, sind materiell wenig komplex und können von den Stimmenden auf der Basis ihrer Alltagserfahrungen, moralischen Überzeugungen und Werte selber eingeschätzt werden. Das Bedürfnis nach zusätzlichen Informationen ist gering und die Möglichkeiten der politischen Beeinflussung sind begrenzt. Beispiele für stabil prädisponierte Abstimmungsthemen sind Vorlagen mit einem starken Bezug zum Alltag (Stimmrechtsalter, Armeeabschaffung, Gurtentragobligatorium) oder zu grundsätzlichen weltanschaulichen Fragen (Schwangerschaftsabbruch).
Dagegen beinhalten labil prädisponierte Abstimmungsthemen eine komplexe Materie, welche zum Alltag der Stimmenden keinen offensichtlichen Bezug hat. Die Mehrheit der Stimmberechtigten hat hier keine vorgefasste Meinung und kann die Vorlage nur schwer in das eigene Wertesystem einordnen. Hier besteht ein Bedarf nach zusätzlicher Information und hier besteht die Möglichkeit der Propaganda, die Stimmberechtigten in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Mit Reizwörtern und Vereinfachungen wird versucht, die Vorlage einer bestimmten Prädisposition zuzuordnen und die Stimmenden dorthin zu platzieren, wo man sie haben möchte. Zu den labil prädisponierten Abstimmungsthemen gehören etwa finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen.
Bei einfachen Themen zielt die Abstimmungskampagne hauptsächlich darauf ab, die bereits Entschlossenen zu bestärken und, vor allem, zum Gang an die Urne zu bewegen. Bei komplexeren Themen dagegen bieten sich der politischen Propaganda verschiedene Möglichkeiten an: Weil eine Abstimmungsvorlage immer mehrere Fragestellungen tangiert, kann jene Frage bzw. jenes Thema besonders hervorgehoben werden, von dem man sich am ehesten Erfolg verspricht. Lässt sich kein solches Thema finden, so kann die Vorlage auch parteipolitisch «aufgeladen» werden, was bedeutet, dass man eine Vorlage unter dem Aspekt diskutiert (und diskreditiert), dass sie von einer bestimmten Partei lanciert wurde oder unterstützt wird.
Die Meinungsbildung findet in einem bestimmten Rahmen statt
Die Schweiz ist kein kulturell einheitliches Land, sondern besteht aus verschiedenen Segmenten, die sich unter anderem durch die Sprache, die Konfession oder durch die Siedlungsart (Stadt/Land) unterscheiden. Dementsprechend gibt es verschiedene regionale politische Kulturen, welche das Abstimmungsverhalten – je nach Thema – unterschiedlich mitbestimmen. So unterscheidet sich etwa das Abstimmungsverhalten der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz bei Volksabstimmungen über aussen- und sozialpolitische Themen: Bei Fragen, welche die aussenpolitische Öffnung der Schweiz betreffen, sind die italienisch- und die deutschsprachige Schweiz meistens auf der ablehnenden Seite, während die französischsprachige Schweiz deutlich zustimmt. Ähnlich verlaufen die Fronten bei Fragen über die Ausländerpolitik. Bei sozialpolitischen Fragen dagegen sind sich meistens die italienische und französische Schweiz einig und sprechen sich mehrheitlich für grosszügigere Lösungen aus, während die Deutschschweiz eher zurückhaltend ist. Ausgeprägt ist schliesslich in der Romandie auch die Favorisierung des Individualverkehrs, während in der Deutschschweiz der Umweltschutz höher im Kurs steht.
Konfessionelle Unterschiede im Abstimmungsverhalten gehörten vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu den dominierenden Konfliktlinien der schweizerischen Gesellschaft. Heute sind diese nur noch gelegentlich präsent; im Zuge der Modernisierung der Gesellschaft haben sie an Brisanz eingebüsst. Immer wichtiger wird dagegen der Unterschied im Abstimmungsverhalten zwischen Stadt und Land. Dieses zeigt sich namentlich bei den Themen der Aussen- und Sozialpolitik sowie der Gleichstellungs- und der Umweltschutzpolitik. Bei aussen- und sozialpolitischen Themen stimmen die deutschsprachigen Städte häufig ähnlich wie die Romandie.
Soviel steht also fest: Die Stimmberechtigten sind kein weisses Blatt Papier, welches man mittels guter Politpropaganda beschreiben kann. Sie sind einerseits von der politischen Kultur geprägt, in der sie aufgewachsen sind und leben, und andrerseits haben sie durch selber gemachte politische und gesellschaftliche Erfahrungen eigene Werte entwickelt. Diesem Sachverhalt muss die politische Propaganda Rechung tragen, wenn sie erfolgreich sein will; sie muss sich auf diese kulturelle Grundlage abstützen.
Kommt dazu, dass es, wie erwähnt, je nach Inhalt der Vorlage gar nicht so einfach ist, Meinungen zu beeinflussen, und dass die politische Kompetenz der Stimmenden im Vergleich zur eingangs erwähnten Studie von Gruner/Hertig eher gestiegen ist. Wie der Politologe Hanspeter Kriesi mit seinen Assistenten/-innen an der Universität Genf festgestellt hat, ist zwar immer noch ein Sechstel der Stimmenden bei den Volksabstimmungen überfordert; fast zwei Drittel haben dagegen eine hohe bis sehr hohe Kompetenz. Dazu beigetragen haben wohl auch die verschiedenen Informationsquellen, die im Vergleich zu den siebziger Jahren – trotz der Medienkonzentration – zahlreicher geworden sind und von denen die Stimmenden im Durchschnitt mindestens vier nützen: am meisten die Zeitungen (von 80 Prozent aller Stimmenden), darauf folgen Fernsehen (75 Prozent), Radio und die Abstimmungserläuterungen des Bundesrates (beide von je 60 Prozent aller Stimmenden).
Diesem Befund steht allerdings die Tendenz gegenüber, dass die Abstimmungskampagnen immer professioneller werden. Die traditionellen Politakteure mit ihrer Milizkampagne machen zusehends Polit- und Marketingprofis Platz, welche zielgruppenspezifisch und mediengestützt vorgehen. Um noch wirkungsvoller zu sein, werden solche Kampagnen längerfristig angelegt, das heisst, es wird versucht, schon in sogenannten Vorkampagnen vorzuspuren und die Stimmberechtigten zu beeinflussen; ein jüngeres Beispiel für eine solche Kampagne ist jene über die Gentechnologie, welche lange vor der Volksabstimmung über die Genschutz-Initiative durchgeführt wurde. Schreitet die Professionalisierung der Abstimmungskampagnen weiter voran, dürfte bald wieder einmal ein Grund gegeben sein, über ungleich lange Spiesse im Abstimmungskampf nachzudenken.
*Dr. Werner Seitz,
Bereichsleiter «Wahlen und Abstimmungen», Bundesamt für Statistik, Sektion Kultur, Politik und Lebensbedingungen.
Dieser Artikel wurde ebenfalls abgedruckt in B-Post. Nachrichten von der kleineren Hälfte, hg. von der Stiftung Märtplatz, Freienstein 2003/4, S. 4–6 und ergänzt um den folgenden Teil:
«Sind Parlamentssitze käuflich?»
Die Frage der Käuflichkeit von Stimmen stellt sich bei den Wahlen noch auf kompliziertere Weise als bei Volksabstimmungen, denn bei Wahlen geht es nicht nur um ein Ja oder Nein zu einem Vorschlag, hier bietet sich in 26 Wahlkreisen (Kantonen) eine breite Palette von Parteien und Kandidierenden an. In diesem Herbst beteiligten sich bei den Nationalratswahlen insgesamt über 2 500 Kandidierende aus rund 15 Parteien.
Doch nicht alle, die kandidieren, haben die gleichen Wahlchancen. Es möchten auch nicht alle gewählt werden. Unter den 964 Kandidatinnen und Kandidaten des Kantones Zürich zum Beispiel rechnen sich wohl höchstens 50–100 Chancen auf einen Mandatsgewinn aus; die übrigen rund 850–900 kandidieren aus anderen Gründen: Sie stellen sich aus Loyalität zur Partei als Listenfüller und Stimmensammlerinnen zur Verfügung oder versprechen sich eine Vergrösserung ihres persönlichen Bekanntheitsgrades für spätere Wahlen. Diese rund 850–900 Kandidierende werden also nur bescheidene personelle Werbung machen.
Die Frage der Käuflichkeit von Parlamentssitzen stellt sich so nur bei den relativ wenigen Personen mit realen Wahlchancen. Doch selbst diese investieren nicht alle «auf Teufel komm raus». Unter ihnen gibt es nämlich einige, die schon längere Zeit im Nationalrat sind und ihrer Wiederwahl getrost entgegen schauen. Christoph Blocher etwa darf sich wohl schon als gewählt betrachten; er wird kaum noch Privatwerbung für sich machen. Auch andere Bisherige, die einen guten parlamentarischen Leistungsausweis haben oder sonst breit abgestützt sind, gehen ruhig in die Wahlen.
Für die Polit-Werbung sind also nur jene Bisherigen interessant, deren Wiederwahl als gefährdet gilt, sowie jene Neulinge, die sich wirkliche Chancen ausrechnen können, gewählt zu werden. Bei letzteren sind die Chancen meistens noch an folgende zwei Bedingungen gebunden:
1) Sie müssen auf den Wahllisten von wählerstarken Parteien kandidieren (und auf diesen sollten sich nicht alles Bisherige bewerben). Auf der Wahlliste einer Splittergruppe aber ist kaum ein Sitz zu gewinnen, auch nicht mit einem grossen Werbeaufwand. Dies ist so, weil die meisten Wahlen nach dem Proporzsystem durchgeführt werden, was heisst, dass die Sitze in erster Linie auf die Parteien verteilt werden und erst in einem zweiten Schritt auf die Kandidierenden mit den besten Stimmenergebnissen.
2) Sie müssen in den grossen Kantonen kandidieren, das heisst in Kantonen, in denen viele Nationalratssitze zu vergeben sind; solche sind namentlich die Kantone Zürich (34 Sitze), Bern (26) und Waadt (18). Es gibt aber auch sechs Kantone, die nur einen einzigen Nationalrat wählen können (UR, OW, NW, GL, AI, AR), und sieben mit nur 2–5 Nationalratssitzen (SH, JU, SZ, ZG, GR, NE, BS). In diesen kleinen Kantonen – sie machen immerhin die Hälfte aller Kantone in der Schweiz aus – ist es sehr schwierig, bisherige Favoriten oder solche, welche die sog. Ochsentour absolviert haben, mit einer noch so raffinierten Wahlkampagne zu verdrängen.
Die grossmaulige Aussage eines Zürcher Werbers, er könne mit einer Million Franken aus einem Kartoffelsack einen Bundesrat machen, ist nicht nur durch die Geschichte widerlegt. Wer das schweizerische Wahlsystem genauer analysiert, sieht, dass nur in einer kleinen Zahl von Fällen mit einem optimalen Werbeeinsatz Sitze «gekauft» werden können. Guido Weber, einer der intelligenteren Politberater, lässt sich zu diesem Thema denn auch wie folgt zitieren: «Wahlen interessieren mich nicht, ich bevorzuge Sachabstimmungen». Zwar können auch Parteien über einen langen Zeitraum hinweg aufgebaut werden, was aber ein bedeutend grösseres Unternehmen darstellt als das «Kaufen» von Sitzen mittels guter Werbekampagne. Jüngstes und eindrückliches Beispiel eines langfristigen Parteiaufbaus ist die SVP. Und hier zeigt sich eine Parallele zum Themensetzen bei Volksabstimmungen: Wer es schafft, über längere Zeit bestimmte Themen zu besetzen oder eine Partei als glaubwürdige Instanz aufzubauen, der hat auch bei den Wahlen die besten Karten. Solche Unterfangen aber sind auch an reichlich verfügbare Geldmittel gebunden.